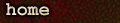 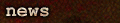     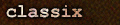    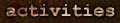   |
Jonathan Lethem - Festung der Einsamkeit „Wie ein entzündetes Streichholz in einem dunklen Zimmer: An einem Juliabend um sieben Uhr zogen zwei weiße Mädchen in Flanellnachthemden auf roten Kunststoffrollschuhen vorsichtig ihre Kreise auf dem geplatzten bläulichen Schiefer des Gehsteigs.“ So beginnen Klassiker – und Lethems sechster Roman ist ein moderner Klassiker. „Die Festung der Einsamkeit“ handelt von den frühen siebziger Jahren in New York, als sich die ersten weißen Familien wieder in das zu der Zeit überwiegend von Schwarzen und Puertoricanern bewohnte Brooklyn trauten und sich dort langsam niederließen. Dylan Ebdus ist Sohn einer solchen weißen Familie. Sein Vater ist Künstler, der seit Jahren Bilder für einen scheinbar nie erscheinenden Film zeichnet – und seine Mutter ist auf einmal verschwunden. Nur durch ominöse und verschlüsselte Postkarten lässt sie noch von sich hören. Dylan lernt in der für ihn völlig neuen und jeden Tag aufs neue bedrohlichen Welt neben allerlei Demütigungen auf der Straße und in der Schule auch den farbigen Mingus Rude kennen, der mit ihm bald durch Dick und Dünn geht. Schnell verlieren sich die beiden in einer eigenen Welt aus Comic-Superhelden, Graffitis, Musik und (in den 80ern) ersten Drogenexperimenten. Die Stimmung, die Lethem mit seiner famosen, anspruchsvollen Sprache, die erstaunlicherweise auch durch die Übersetzung nicht leidet, einfängt, erinnert manchmal an den Filmklassiker „Es war einmal in Amerika“. Dylan ist melancholisch und hoffnungslos, dann, wenn der Sommer wie jedes Jahr die Kälte, die Schule und die Angst vor den immerwährenden Entwürdigungen mit seinen wärmenden Sonnenstrahlen verscheucht, wieder frohgestimmt und beinahe heldenhaft – Lethem beherrscht die Klaviatur der Emotionen wie nicht viele Autoren der letzten Jahre. Das letzte Drittel des Buches markiert erzähltechnisch einen ziemlich ungewöhnlichen Schnitt, der manche stören könnte – die Erzählweise wechselt urplötzlich zur Ich-Perspektive und Dylan macht sich noch einmal auf die Suche nach der Vergangenheit – und seiner eigenen Identität, die auch die Kindheit in Brooklyn nicht vollends zerstören konnte. „Die Festung der Einsamkeit“ ist dennoch ein großes, wirklich wunderbares Buch, das einen, kaum angefangen, nicht mehr loslässt.
(c) 2005, Michael Kohsiek
|
|||

|
||||